Können Facebook, Twitter und Co. das eigene Gesundheitsverhalten positiv beeinflussen? Sie hätten zumindest das Zeug dazu. Doch ohne die richtigen Inhalte ist im Web 2.0 alles nichts. Social Media werden nur dann den größten Einfluss haben, wenn der Content, den die Tools und Apps transportieren, der individuellen Wirklichkeit des einzelnen Users entspricht. Was aber, wenn im Gesundheitswesen seit Jahr und Tag die falschen Inhalte thematisiert werden? Was, wenn die Rückenschmerzen nicht auf Bewegungsarmut beruhen, sondern in Wahrheit von einem sich unmöglich gebarenden Chef verursacht werden? Sind Physiotherapie und Fango dann wirklich die richtige Therapie oder nur eine Maßnahme unter anderen, sofern die „Behandlung“ nachhaltig sein soll? Faktoren wie Ärger im Büro, aber auch Geldsorgen oder Eheprobleme und ihr Einfluss auf die Gesundheit sind zwar bekannt, werden aber für gewöhnlich vernachlässigt oder einfach nicht erwähnt, wie eine kürzlich erschienene amerikanische Studie herausgefunden hat.[1] Große Areale des Alltags werden in den USA damit einfach aus der Diskussion ausgeblendet. Dies nahmen die Veranstalter der Konferenz „Health 2.0“, die vom 7. bis 8. Oktober 2010 in San Francisco stattfand, zum Anlass, diesen so genannten „Unmentionables“ eine eigene Session einzuräumen.[2] Dadurch wurde „das Unaussprechliche“ nicht nur ausgesprochen, sondern es wurde anhand ausgewählter Beispiele diskutiert, welche Chance Social Media hinsichtlich individueller Krankheitsvorbeugung bieten. Der vorliegende Beitrag bündelt die Ergebnisse und leitet daraus strategische Empfehlungen ab, wie Social Media sein müssen, damit sie das Gesundheitsverhalten nachhaltig positiv beeinflussen.[3]
Sex, drugs, and a crappy boss
Acht Stunden Schlaf pro Tag, maßvolle und ausgewogene Kost, kein Nikotin, die Liebe seines Lebens suchen, finden und ausleben, sich um andere kümmern, sich dabei aber nicht aufopfern – und sich vor allem nicht selbst zu vernachlässigen: eigentlich wissen wir damit, was zu wahrer Gesundheit führt, so Susannah Fox in ihrer Anmoderation der Session. Aber wir verhalten uns nicht danach. Warum ist das so?
Es ist nicht immer Willensschwäche, der Gründe sind viele. Wir kennen das doch sicherlich alle: wir wollten mehr Zeit an der frischen Luft verbringen, haben am Wochenende aber wieder einmal den Hintern nicht hochbekommen. Vielleicht haben wir vorgeschoben, eine Arbeit für den Chef erledigen zu müssen – vielleicht mussten wir sie auch tatsächlich erledigen. Und überhaupt kann der „Chef“ – sofern wir ihn einmal als Metapher für all das, was im Büro schief läuft, heranziehen dürfen – leicht zu einem der zentralen Gründe für Krankheit werden. Der provokative Untertitel „Sex, drugs, and a crappy boss“, den die amerikanische Eliza Corporation ihrer empirischen Studie „The Unmentionables™“ gegeben hat, kommt also leider nicht von ungefähr.[4]
Animation statt Reanimation
Gibt es Warnzeichen, wenn Leute durchdrehen? Möglicherweise ja, denn hinter vielen somatischen Erkrankungen versteckt sich eine psychische Mitbeteiligung, etwa bei Rückenschmerz, Migräne und Adipositas.[5] Dies ruft die Krankenkassen auf den Plan, etwa die AOK Rheinland/Hamburg[6] oder die Barmer GEK, die „mehrdimensionale Präventionskonzepte“ propagieren lässt, „die bereits in Schulzeit und Ausbildung darauf abzielen, einen eigenverantwortlichen Umgang mit den persönlichen Ressourcen für Gesundheit und Krankheit zu entwickeln“.[7]
In Deutschland scheint das Burn-out-Syndrom momentan so etwas wie das unangefochtene Buzzword der „Unaussprechlichen“ zu sein, die hier überwiegend im Zusammenhang mit salutogenetischen Konzepten wie Prävention und betrieblicher Gesundheitsförderung auftauchen. Laut einer Studie der Bundespsychotherapeutenkammer gingen 2009 knapp elf Prozent aller Fehltage auf das Konto psychischer Erkrankungen. Damit habe sich die Zahl solcher Krankschreibungen seit 1990 fast verdoppelt.[8] Der volkswirtschaftliche Schaden – alles andere einmal ausgeklammert – ist enorm.
 Die Sternstunde der Gesundheitskommunikation war der Moment, in dem sich der Schwerpunkt von der rein kurativen zur präventiv-kurativen Medizin verlagert hat und vorrangig das Ziel einer Prävention durch Gesundheitsförderung verfolgt wurde. Dies geht nur über Kommunikation. Zunehmend setzen Krankenversicherungen oder die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung daher auf Social Media, letztere etwa mit der auf Facebook, MySpace und in den VZ-Netzwerken vertretenen Kampagne „Alkohol? Kenn dein Limit.“ Die (Prä-)Patientenkommunikation ist primär Aufklärungsarbeit, über Bonusprogramme werden Versicherte animiert, ihre Gewohnheiten zu ändern, wodurch sich die Kassen langfristig Kostenreduzierungen erhoffen. Und neuerdings unterstützen sie die Nationale Kontakt- und Informationsstelle zur Anregung und Unterstützung von Selbsthilfegruppen (NAKOS) bei der Organisation von Online-Selbsthilfegruppen.[9]
Die Sternstunde der Gesundheitskommunikation war der Moment, in dem sich der Schwerpunkt von der rein kurativen zur präventiv-kurativen Medizin verlagert hat und vorrangig das Ziel einer Prävention durch Gesundheitsförderung verfolgt wurde. Dies geht nur über Kommunikation. Zunehmend setzen Krankenversicherungen oder die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung daher auf Social Media, letztere etwa mit der auf Facebook, MySpace und in den VZ-Netzwerken vertretenen Kampagne „Alkohol? Kenn dein Limit.“ Die (Prä-)Patientenkommunikation ist primär Aufklärungsarbeit, über Bonusprogramme werden Versicherte animiert, ihre Gewohnheiten zu ändern, wodurch sich die Kassen langfristig Kostenreduzierungen erhoffen. Und neuerdings unterstützen sie die Nationale Kontakt- und Informationsstelle zur Anregung und Unterstützung von Selbsthilfegruppen (NAKOS) bei der Organisation von Online-Selbsthilfegruppen.[9]Social Media haben in vielerlei Hinsicht zu einem Paradigmenwechsel in der Gesundheitskommunikation geführt. Sofern aber alle diese Kampagnen und Kommunikationsformen, bei denen es ja um individuelle Krankheitsvorbeugung geht, von Erfolg gekrönt sind, steht uns nichts Geringeres als der „Salutogenetic Turn“ im Online-Kundendialog bevor.
Das Elvis-Paradoxon
 |
| Elvis - rank und schlank |
Social Media ermöglichen die zeitnahe und mobile soziale Interaktion und Kollaboration zwischen Menschen direkt und in Echtzeit und bedienen sich dazu ausschließlich online-basierter Kommunikationskanäle und Anwendungen. Sie sind damit potenziell allgegenwärtig, sozusagen „vor Ort“, „am Mann“ bzw. „an der Frau“. Das macht Health 2.0-Anwendungen, also Social Media mit Bezug zum Gesundheitswesen, zu idealen Transportern, um das Gesundheitsverhalten positiv zu beeinflussen. Allerdings nur zu Transportern, denn das Medium ist bekanntlich nicht die Botschaft (im Sinne Marshall McLuhans), abgesehen vielleicht von Apples iPhone und iPad. Health 2.0 darf nicht beim Wissensaustausch stehen bleiben, sondern muss Wissen in Aktion überführen. Also exakt das, was Elvis Presley einst mit „A little less conversation, a little more action please“ eingefordert hatte.
Dass der King aber seinen Lebensstil nicht nach dieser Maxime ausgerichtet hat, ist hinlänglich bekannt. Warum ist es demnach so schwer, den inneren Schweinehund zu überwältigen, und wie vor allem sorgen Social Media dafür, dass auf Worte Taten folgen, etwa dass ein Herzinfarktpatient einen Rückfall in bewegungsarme und hektische Lebensweisen vermeidet? Zehn Bedingungen müssen gegeben sein, damit Social Media einen so großen Mehrwert für den User generieren, dass Kommunikation handlungsrelevant wird.
Bedingung 1: Kennt Eure Ziele!
Jeder Businessplan beginnt mit einem klaren Ziel. Und das ist bei Social Media-Strategien genauso: man muss seine Ziele kennen, wissen, was man will und wohin man will. Das setzt voraus, dass man zwischen der Erhöhung von Reichweite („awareness“) einerseits und der Erweiterung der Bandbreite der Mitteilungen andererseits unterscheidet. Und dazu gehört auch, den Online-Gesundheitsdiskurs aktiv zu überwachen. Dafür gibt es bereits Tools, so genannte Infoveillance-Werkzeuge wie News-Aggregatoren (themenunspezifische Aggregatoren wie z. B. Wikio.de, OurSignal.com, PopUrls.com u. a., auf Medizin bezogene wie z. B. Health.alltop.com und die RSS-Feeds von MedicineNet.com).
Bedingung 2: Kennt Eure Zielgruppe!
Zwar bestehen Märkte tatsächlich aus Menschen und nicht aus demografischen Daten, wie das Cluetrain Manifest postuliert.[10] Doch ganz ohne Daten geht’s dann doch nicht. Um gezielt ansprechen zu können, muss man wissen, wen man anspricht. Seine Dienstleistungen und Produkte unspezifisch unter die breite Masse zu bringen war gestern. Heute geht es nur noch um Teilzielgruppen. Die Zielgruppenansprache ist im Präventionsbereich bereits eine feste Orientierungsgröße. Auf Neudeutsch heißt sie nun Targeted Health Communication.[11] Darunter versteht man maßgeschneiderte Kommunikation, also eine stärker individualisierte Form der Kommunikation, die auf Informationen über Merkmale seiner Zielgruppe basiert. Weil sie direkt auf die spezifischen Bedürfnisse des Individuums zugeschnitten ist, ist sie wirksamer als so genannte generische, also allgemeine Gesundheitskommunikation und andere über-individuelle Konzepte zur Förderung gesunder Verhaltensweisen. Die Untergruppen sind jedoch nicht homogen. Denn neben demografischen Faktoren, welche die Individuen zwar homogen erscheinen lassen, gibt es auch solche nicht-demografischer Natur. Dennoch lässt sich feststellen, dass zielgerichtete Kommunikation effektiver ist.
Je mehr Informationen man über die vorgesehenen Empfänger der Mitteilung hat, desto besser ist man gerüstet, um Kommunikation so zu gestalten, das sie auf die spezifischen Bedürfnisse der Personen individuell ausgerichtet ist.
Es geht aber nicht nur um Daten wie Alter, Geschlecht, Migrationshintergrund, Bildungsgrad usw., die sich vergleichsweise einfach aus statistischen Daten erheben lassen, sondern auch um Lebenswelten, Lifestyle, Verhaltensmuster usw., kurz: um Einblicke in Lebenswelten. Denn auch diese beeinflussen die Gesundheit der Menschen im Zusammenhang mit Entscheidungen und Handlungen. Diese sind allerdings nur mit viel Aufwand zu erheben, was u. a. die Kosten für sozialwissenschaftliche Untersuchungen wie die Sinus-Studien erklärt.[12]
Eine maßgeschneiderte Gesundheitskommunikation muss alle verfügbaren Informationen zu individuellen Bedürfnissen, Interessen und Anliegen nutzen, damit sie Gesundheitsnachrichten und -materialien schaffen kann, die zu bestimmten Person passen, also hoch individualisiert sind.
Bedingung 3: Wisset, in welchen Netzwerken sie sich aufhält!
Klassische Prävention hält sich möglichst nahe am Point of Sale ab: um effektiv über die Gesundheitsrisiken des Rauchens zu informieren empfiehlt die WHO, die Warnhinweise direkt auf den Zigarettenverpackungen zu platzieren, wobei sich die Kombination von textlichen und bildlichen Warnhinweisen als am effektivsten herausgestellt hat.[13] Die Sozialen Netzwerke sind so etwas wie der Point of Sale. Dabei dürften Smartphones der ultimative Point of Sale sein: näher am „Kunden“ geht’s nicht.
Aber wo ist die Zielgruppe aktuelle online? Frauen zwischen 18 und 24 Jahren sind vergleichsweise häufig auf Twitter aktiv, bei Männern ist es die Altersgruppe zwischen 25 und 34 Jahren.[14] Und wie bewegt sich die Zielgruppe im Sozialen Netzwerk? Dies zu wissen ist für die Social Media Strategie eine wichtige Voraussetzung.[15] Hat ein Thema z. B. viele engagierte Fans („Creators“), lassen sich diese beispielsweise aktiv einbinden in Patientennetzwerke oder interaktive Wettbewerbe. Verhalten sie sich hingegen eher passiv („Spectators“), könnte ein eigenes Corporate Blog oder eine Multimedia-Plattform der vielversprechendere Ansatz sein.
Die Zielgruppe mit ihrem Aufenthaltsort und die mit dem Netzwerk verbundenen Normen geben also vor, wo und damit auch wie die Diskussion zu erfolgen hat. Mitunter auch crossmedial, wobei eine umfassende Social Media Strategie bislang noch die Ausnahme ist: nur 5% bedienen zugleich Facebook, Twitter, YouTube und Corporate Blogs.[16] Allerdings gibt es einen Trend in Richtung Plattformkonvergenz der belegt, dass Kommunikation mittels Social Media ein höchst komplexes und zusammenhängendes System ist: Twitter verweist auf YouTube, Widgets ermöglichen einen Zugriff auf Facebook, RSS-Feeds verbinden die Benutzerschnittstelle mit dem Netz – und alles spielt sich zunehmend auf mobilen Endgeräten ab.[17]
Bedingung 4: Und sprecht ihre Sprache!
Der Mehrwert maßgeschneiderter Nachrichten besteht gerade darin, den Einzelnen aktiv in den Veränderungsprozess mit einzubeziehen. Darum müssen Social Media kommunikationsfreudig („sociable“) sein. Gerade die Sprache selbst verhindert das aber oft. Auf diesen Widerspruch machte Doug Solomon aufmerksam. Zwar wüssten die Social Media Manager dieser Welt sehr genau, welche Teilzielgruppe sie über welche Medien erreichen wollen, doch mangele es schlussendlich an der zielgruppengerechten Ansprache. Dann könne man es auch gleich vergessen, denn solche Kampagnen hätten nicht die leiseste Chance Beachtung zu finden.
Solomon arbeitet an Konzepten zur Verhinderung ungewollter Schwangerschaften unter amerikanischen Teenagern. Die Palette im Kommunikationsmix reicht dabei von Flugblättern an Laternenmasten über SMS bis zu YouTube-Videos. Gerade hier komme es aber auf die richtige Ansprache an: denn Sex, so Solomon, sei für die Teenager kein steriles Unterfangen, sondern ein sinnliches Vergnügen. Daher seien Aufklärungskampagnen, die nur sterile Botschaften herausposaunten, anstatt eine körperlich-sinnliche Sprache zu verwendeten, allein schon aus dem Grunde zum Scheitern verurteilt, dass der Sprachduktus weder zum Thema noch zum Soziolekt passe.
Botschaften müssen so gestaltet sein, dass die Teilzielgruppen sie auch hören wollen. Und sie müssen sie verstehen können, wozu sie einfach sein müssen. Darüber hinaus sollen sie generell humorvoll, verbindlich, dialogorientiert, hilfsbereit und menschlich sein. Auch der Sprachduktus der Bevormundung sollte vermieden werden. Und erst recht sollten Social Media eindeutig werbliche Aussagen vermeiden. Solomon endete sein Plädoyer mit dem eingängigen Slogan „Real language for real people“, und das trifft die Wirklichkeit in Social Media recht gut.
Bedingung 5: Gebt Feedback, unbedingt!
Social Media fördern die Gesundheit umso besser, je mehr Feedback sie ihren Nutzern geben, sagt Ron Gutman. Ein Spiel ohne Ergebnisanzeige und Rangfolge sei doch auch reichlich öde, oder? Mit seiner Firma HealthTap arbeitet Gutman am Konzept der personalisierten Medizin. Zukünftig soll es möglich sein, sich per Smartphone immer dann in seine personalisierten medizinischen Daten einzuloggen, wenn einem danach ist, unabhängig davon, wo man sich gerade befindet, um sodann sein eigenes Wohlbefinden selbst zu beeinflussen. Auf der Grundlage von Daten, die der User selbst eingibt, generiert der „Personal Health Companion“ Informationen, gleicht diese mit Millionen von anderen Informationen ab, um diese in eine Empfehlung zu überführen, die möglichst einfach gehalten ist. Und diese wird dann an den User zurückgegeben, der dann diese Empfehlung in eine Handlung überführen soll. Okay…
Sind wir damit nicht wieder am Ausgangspunkt angekommen, dem Elvis-Paradoxon? Nein, meint Gutman, wenn es gut gemacht ist, handeln die Patienten. Dass dies zumindest wahrscheinlich ist, legt eine Studie nahe. Immerhin 79% von Patienten, die an einem Online-Gesundheitsprogramm teilnahmen und begleitend dazu an einem Online-Patientenforum, zogen das Programm bis zum Ende des Kurses durch. Von Patienten, die nicht an Social Media teilnahmen, beendeten nur 66% den Kurs.[18] Diese Befunde dürften z. B. für Krankenversicherungen hinsichtlich der Effizienzsteigerung von Bonusprogrammen hochinteressant sein.
Eine Meta-Studie, die begleitend zu der erwähnten Studie stattfand, ergab, dass die Online-Gesundheitsprogramme umso erfolgreicher waren, wenn die Diskussion in nur wenigen Patientenforen stattfand anstatt in vielen unterschiedlichen, zum Teil spezialisierten Foren. Der wesentlich interessantere Befund dürfte aber der sein, dass man unbedingt Personal benötigt, welches die Anfragen von Usern beantwortet für den Fall, dass die Community dies nicht selbst tut, und die darüber hinaus selbst Diskussionen anbahnen, wenn im Forum gerade Funkstille herrsche. Dazu könnten z. B. auch Wettbewerbe mit kleinen Preisen ein adäquates Mittel.[19] Darüber hinaus ist es unter Umständen auch zu vermeiden, die Meinungsführerschaft aus der Hand zu geben.
Stichwort Personal: gerne wird übersehen, dass Social Media die laufende Überwachung der Kommunikation erfordern. Daher ist es wichtig, ausreichend Ressourcen für das Feedback bereitzuhalten. Die einzelnen sozialen Netzwerke und Dienste nehmen dabei höchst unterschiedliche Rollen in der Kommunikation ein. Die bereits erwähnte automatisierte Verbindung verschiedener solcher Plattformen wie LinkedIn, Xing, Twitter, Facebook und Youtube führt zwar zur Reduzierung des Arbeitsvolumens. Für Reaktionen auf mögliche Kommentare und Antworten gilt dies jedoch keineswegs.[20] Während Facebook und Twitter rasche Clearance-Prozesse erfordern, weil sie in Echtzeit Interaktionen mit Benutzern ermöglichen, ist der Feedback-Faktor etwa bei YouTube wesentlich unkritischer.
Bedingung 6: Schafft Anreize!
 Der Gedanken eines Anreizsystems ist für Zamzee maßgeblich. Bei Zamzee handelt es sich um ein so genanntes Lifestyle Tracking-Projekt zur Prävention von Adipositas bei Kindern und Jugendlichen. Bewegungsverhalten soll verändert werden, indem Spielelemente mit einem Belohnungssystem verbunden werden und darüber mit einer Art Schrittzähler, dem „Zamzeemeter“, automatisch Buch geführt wird. Dieses Gerät wird einfach an den PC angeschlossen, die Daten werden hochgeladen und automatisch dem eigenen Konto in Form von Aktivitätspunkten gutgeschrieben. Je mehr sich die Kids bewegt haben, desto mehr Punkte erhalten sie. Diese Punkte geben nun nicht nur den Online-Status an, sondern können in Währung umgewandelt werden, diese dann im Zamzee Store ausgegeben werden. Bewegung gleich welcher Art zahlt sich im wahrsten Sinne des Wortes aus. Ob die Kids dabei laufen, tanzen oder Skateboard fahren – was nebenbei gemerkt unendlich viel cooler ist als Runden auf der Aschenbahn zu drehen – ist völlig egal: Spaß soll es machen, denn am Ende zählt nur die Bewegung und die liege, so Richard Tate, der Direktor von HopeLab, bei einer zusätzlichen ¾ Meile mehr am Tag als vor Zamzee.
Der Gedanken eines Anreizsystems ist für Zamzee maßgeblich. Bei Zamzee handelt es sich um ein so genanntes Lifestyle Tracking-Projekt zur Prävention von Adipositas bei Kindern und Jugendlichen. Bewegungsverhalten soll verändert werden, indem Spielelemente mit einem Belohnungssystem verbunden werden und darüber mit einer Art Schrittzähler, dem „Zamzeemeter“, automatisch Buch geführt wird. Dieses Gerät wird einfach an den PC angeschlossen, die Daten werden hochgeladen und automatisch dem eigenen Konto in Form von Aktivitätspunkten gutgeschrieben. Je mehr sich die Kids bewegt haben, desto mehr Punkte erhalten sie. Diese Punkte geben nun nicht nur den Online-Status an, sondern können in Währung umgewandelt werden, diese dann im Zamzee Store ausgegeben werden. Bewegung gleich welcher Art zahlt sich im wahrsten Sinne des Wortes aus. Ob die Kids dabei laufen, tanzen oder Skateboard fahren – was nebenbei gemerkt unendlich viel cooler ist als Runden auf der Aschenbahn zu drehen – ist völlig egal: Spaß soll es machen, denn am Ende zählt nur die Bewegung und die liege, so Richard Tate, der Direktor von HopeLab, bei einer zusätzlichen ¾ Meile mehr am Tag als vor Zamzee.Die Kosten für diese Incentives betragen 5 bis 20 US-$. Eine Gesamtangabe zur Höhe der Kosten des Programms existiert nicht, aber verglichen mit den Kosten, die das amerikanische Gesundheitssystem jährlich für die Folgeerkrankungen von Adipositas aufwenden muss, dürften sie geradezu lächerlich gering sein. Tate bezifferte diese Ausgaben auf 100 Milliarden US-$, eine Studie von PriceWaterhouseCoopers sogar auf das Doppelte.[21] Damit wären die Ausgaben für Adipositas höher als für andere Erkrankungen, die auf so genannten „schlechten Patientenentscheidungsfindungen“ beruhen, etwa Alkohol- und Nikotinkonsum oder auch das Versagen, sich an vorgeschriebene Medikationen zu halten.
Bedingung 7: Macht Spaß!
Anreizsysteme wie Bestenlisten und kleine Incentives nützen letztendlich herzlich wenig, wenn der Spaßfaktor fehlt. Und Spaß kann ja so motivieren! Im Online-Bereich weiß man das spätestens seit 1999, als das „Moorhuhn“ das Licht der Welt erblickte, nur um gleich darauf wieder abgeknallt zu werden, was zu einer Art Volkssport in deutschen Büros wurde. Und auch der Siegeszug der Smartphones kommt nicht von ungefähr. In Zeiten, wo die technische Ausstattung einen ohnehin so hohen Standard erreicht hat, dass die einzelnen Endgeräte kaum noch unterscheidbar sind, sind funktionale Features beim Handykauf nicht mehr so wichtig wie der Spaß- und Erlebnisfaktor. Dazu bedarf es lediglich eines entsprechenden Betriebssystems, gekoppelt mit der Möglichkeit, im Internet surfen und Apps installieren zu können. [22] Und diese müssen so programmiert sein, dass sie Spaß machen.
Bedingung 8: Keine Tabus!
Auch im Mutterland der sexuellen Revolution hat sich das Sexualverhalten durch AIDS seit den 1980er Jahren sehr geändert. Schade, muss sich Ramin Bastani gedacht haben, es wäre doch viel einfacher, wenn man Informationen zum Gesundheitszustand seines Gegenübers per Knopfdruck aufs Handy bekäme. Sprach’s und entwickelte den SMS-Service Qpid.me, der getreu dem Motto „Spread the Love, Nothing Else“ die aktuellen Testergebnisse in puncto AIDS, Syphilis und anderer sexuell übertragbarer Krankheiten aufs Mobiltelefon des jeweiligen potenziellen Partners für die Nacht sendet. Dadurch hat Health 2.0 nun auch noch den One-Night-Stand revolutioniert…
Bedingung 9: Hey, ich sagte doch keine Tabus!
Keine Tabus hat auch noch eine weitere Bedeutung. Mit Bezug zur Eliza-Studie „The Unmentionables™“ zeigte sich der Blogger Michael Millenson darüber enttäuscht, dass die eigentlichen „Unaussprechlichen“ in der Session überhaupt nicht angesprochen worden wären. Das eigentlich „Unaussprechliche“ sei doch nicht, wie sich Eheprobleme oder Stress im Job auf die Gesundheit auswirkten, sondern der Zusammenhang zwischen Gesundheit und sozialer Klasse.[23] Zwar hätte z. B. Zamzee das Problem des Übergewichts thematisiert, jedoch sei mit keiner Silbe erwähnt worden, dass Adipositas immer auch im Zusammenhang mit der Zugehörigkeit zur Ethnie gesehen werden müsse, denn der Anteil an fettleibigen Kindern und Jugendlichen sei unter Menschen lateinamerikanischer oder afrikanischer Herkunft noch dramatischer. Bei solchen Themen aber auch Themen wie dem Zusammenhang zwischen Alter und Gesundheit fühlten sich viele Amerikaner eher unbehaglich, weshalb die Themen gerne unter den Tisch fielen, so Millenson.
Soziale Tabus sind so etwas wie die Störquelle im Sender-Empfänger-Modell. Tabus unterdrücken die Thematisierung von Details des täglichen Lebens, die „peinlich“ sind: bestimmte Körperfunktionen etwa, sexuelle Probleme und anderes, was sozial ausgrenzend wirkt. In letzter Konsequenz gefährdet das Unbehagen an solchen Themen Gesundheit und verhindert Lebensqualität, weil sie den Informationsfluss behindern oder wichtige Informationen vorenthalten.
Bedingung 10: Bedenket eure Halbwertszeit!
Ein jegliches hat seine Zeit, und wie Wissen generell, so hat auch das Wissen im Internet seine Halbwertszeit, und dies ist in zweifacher Hinsicht relevant.
Zum einen ist im Internet gerade immer irgendetwas anderes angesagter als die eigene Social Media-Kampagne. Diese sollte daher von langer Lebensdauer sein, was bei der Konzeption zu berücksichtigen ist. Und für den Fall, dass sie dann eines Tages obsolet wird, bedarf es einer Ausstiegsstrategie und generell klarer Prozesse, wie das Material zu archivieren ist.
Zum andern kann Wissen veralten. Daher ist es wichtig, das Wissen mit Zeitangaben zu versehen, so dass der Nutzer weiß, dass eine Information nicht mehr zeitnah ist. Gerade in der Medizin ist dies von besonderer Bedeutung. Gesundheitsinformationen, die nicht auf dem neuesten Stand der Medizin sind, sind im besten Fall überflüssig, im schlimmsten Fall aber schädlich. Oder würde man heute bei Halsschmerzen noch mit Kaliumpermanganat gurgeln? Eben, und daher sollten Kampagnen auch gelöscht werden können.
Ausblick
Das Problem der Halbwertszeit galt auch für den King. Wie man weiß, wurde aus „Elvis the Pelvis“ im Laufe der Jahre „Elvis the Breathless“. Dass das Elvis-Paradoxon jemals restlos durch Health 2.0 aufgelöst werden wird, darüber sollte man sich daher lieber keine allzu großen Illusionen machen. Immerhin wissen wir jetzt aber, welche zehn Bedingungen gegeben sein müssen, damit Social Media in puncto Gesundheitsförderung wirkmächtig werden können. Abschließend sei nochmals darauf hingewiesen, dass ohne glaubwürdigen und authentischen Inhalt in Sozialen Netzwerken alles nichts ist. Wie so oft heißt auch in Sozialen Netzwerken das Zauberwort schlicht Mehrwert, und für eine erfolgreiche Gesundheitskommunikation wird zukünftig immer stärker der Mehrwert der angebotenen Informationen ausschlaggebend sein.
Anmerkungen
Datum aller Zugriffe: 2011-03-09
[1] Online verfügbar: http://bit.ly/eMVXRR
[2] Die Health 2.0-Konferenz wird vom gleichnamigen Gesundheitsnetzwerk veranstaltet. Sie findet seit 2006 zweijährlich statt und ist in den USA die Leitkonferenz der miteinander verschmelzenden Branchen Gesundheit und Digitalwirtschaft. Online verfügbar: http://bit.ly/fN0lDK
[3] Dieser Beitrag knüpft thematisch an diesen an: Ulrich Wirth: Neues aus Digit@lien – Soziale Netzwerke im Gesundheitssektor (1). Zur Ortsbestimmung von Health 2.0 in Europa. In mdi – Forum der Medizin_Dokumentation und Medizin_Informatik 2 (2010), S. 67-73.
[4] Online verfügbar: http://bit.ly/gDMC5s. Auch in Deutschland ist der Chef Kündigungsgrund Nummer 1, wie eine Studie der Ruhr Universität Bochum herausgefunden hat: http://bit.ly/Pdau5
[5] Vgl. dazu Bernhard van Treeck: Langzeitarbeitsunfähigkeit bei psychischen und psychosomatischen Erkrankungen. SEG1-Expertentagung, Hannover, 30. Juni 2006, S. 4. Online verfügbar: http://bit.ly/gwPkaU
[6] Karin Zeidler: Projekt „Psychiatrisches Fallmanagement“ der AOK Rheinland/Hamburg. Langzeitarbeitsunfähigkeit bei psychiatrischen und psychosomatischen Erkrankungen. Problematik aus der Sicht der Krankenkasse. MDA-Abschlussarbeit (masch.). Trier 2010.
[7] Online verfügbar: http://bit.ly/gAWymv
[8] Online verfügbar: http://bit.ly/eDM80I
[9] Online verfügbar: http://bit.ly/hluZKK
[10] Online verfügbar: www.cluetrain.com
[11] Vgl. dazu Shawn Davis: Internet-Based Tailored Health Communications. History and Theoretical Foundations. In: Interface. The Journal of Education, Community, and Value 3 (2007). Online verfügbar: http://bit.ly/ih4dxn, Matthew W. Kreuter, Victor J. Strecher und Bernard Glassman: One size does not fit all. The case for tailoring print materials. In: Annals of Behavioral Medicine 4 (1999), S. 276-283 und William Rakowski: The potential variances of tailoring in health behavior interventions. In: Annals of Behavioral Medicine 4 (1999), S. 284-289.
[12] Online verfügbar: http://www.sinus-institut.de
[13] Geoffrey T. Fong, David Hammond und Sara C. Hitchman: The impact of pictures on the effectiveness of tobacco warnings. In: Bulletin of the World Health Organization 87 (2009), S. 640-643. Online verfügbar: http://bit.ly/gqta5p
[14] Online verfügbar: http://bit.ly/co8rj2
[15] BITKOM (Hg.): Leitfaden Social Media. Berlin 2010, S. 12. Online verfügbar: http://bit.ly/ggn3uY
[16] Bezogen auf die 100 größten Marken in Deutschland. Online verfügbar: http://bit.ly/hBo0lj
[17] Christine McNab: What social media offers to health professionals. In: Bulletin of the World Health Organization 87 (2009), S. 566. Online verfügbar: http://bit.ly/84Aylw
[18] Online verfügbar: http://bit.ly/hwLz9Z
[19] Ebd.
[20] Vgl. Anm. 15, S. 14.
[21] Online verfügbar: http://bit.ly/eqsAbQ
[22] Dies ergab eine GfK-Studie in Deutschland, Spanien, Großbritannien, China, Brasilien und den USA, für die jeweils zwischen 500 und 1.000 Mobiltelefonbenutzer in den einzelnen Ländern befragt wurden. Online verfügbar: http://bit.ly/hccwN3
[23] Online verfügbar: http://bit.ly/hLUoy5
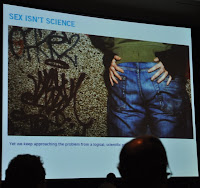
Tidak ada komentar:
Posting Komentar